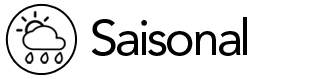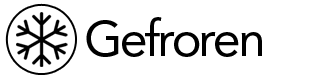Kaum ein Fisch erzählt so viele Geschichten wie der Hering. Seit Jahrhunderten hat das „Silber des Meeres“ ganze Küstenregionen ernährt, geprägt und reich gemacht. Der Hering ist ein echter Verwandlungskünstler und aus der traditionellen Küche Europas nicht wegzudenken. Hering kann frisch gebraten oder gegrillt, verarbeitet zu Matjes, Rollmops und Bismarckhering oder geräuchert verzehrt werden. Hinter dem Begriff „Hering“ steckt eine ganze Familie von Fischarten mit faszinierender Lebensweise, cleveren Schwarmtechniken und großer ökologischer Bedeutung. Was viele überrascht: Er ist nicht nur lecker, sondern auch ein echtes Superfood, reich an Omega-3-Fettsäuren und hochwertigen Spurenelementen. In diesem Blogbeitrag zeige ich Ihnen, warum der Hering mehr ist als nur ein Klassiker. Er ist ein Stück Kultur, wichtiger Bestandteil des Ökosystems und wertvolles Lebensmittel zugleich.

Was ist ein Hering?
Der Begriff “Hering” ist in der Wissenschaft eine Sammelbezeichnung für eine Familie von Meeresfischen (Clupeidae) mit ca. 200 Arten. Die bekanntesten Arten sind der Atlantische Hering und die Europäische Sprotte, aber auch Sardine und Maifisch gehören zur Familie der Heringe. Heringe sind pelagische Salzwasserfische und kommen als verschiedene Art in fast allen Weltmeeren vor. Sie gelten als eine der häufigsten Fischarten - einer Theorie nach leitet sich sogar der Name “Hering” vom deutschen, “Heer” für “Haufen, Menge” ab.
Sie bilden große Schwärme, die zur Laichzeit mehrere Millionen Individuen umfassen und sich über Kilometer erstrecken können. Heringe halten sich meist im Freiwasser in Tiefen bis 350 Metern auf und folgen nachts ihrer Nahrung bis an die Oberfläche. Historisch wurde der Hering oft als “Silber der Meere” bezeichnet, ein Hinweis auf seine silberfarben schimmernde Erscheinung im Sonnenlicht, sondern auch auf seine große wirtschaftliche Bedeutung als Speisefisch.
Wenn man in Deutschland vom Hering spricht, ist fast immer der Atlantische Hering (Clupea harengus) gemeint. Als sogenannter euryhaline Fisch kann der Hering in einem weiten Spektrum von Salzgehalten leben. Die nördlichen Meere Europas (Nordsee, Ostsee und Nordostatlantik) beheimaten große Populationen, aber auch im Brackwasser des Greifswalder Bodden oder des Darß-Zingster Bodden fühlen sich die Heringe wohl.
Heringe sind als Nahrungsquelle ein wichtiger Bestandteil des marinen Ökosystems, z. B. für Meeressäuger (Robben und Wale), für Raubfische (Dorsch, Thunfisch und Makrele), für Seevögel und viele weitere Fischarten. Für uns Menschen ist der Hering seit jeher Grundlage für unterschiedlichste traditionelle Spezialitäten wie Matjes, Rollmops oder Bismarckhering in Deutschland, Smørrebrød in Dänemark oder fermentiert als Surströmming in Schweden.

Wie sieht ein Hering aus?
Der Atlantische Hering hat einen schlanken, langgestreckten und seitlich abgeflachten Körper. Seine Flanken glänzen silbrig, der Rücken kann stahlblau, grau oder grünlich sein, der Bauch ist weiß. Heringe können bis zu 20 Jahre alt werden. Sie können bis maximal 40 cm lang und ca. 1 kg schwer werden.
Im Durchschnitt bleiben sie eher kleiner, je nach Saison und Herkunft ca. 20-35cm mit Gewichten zwischen 100 und 500g. Im Unterschied zu anderen Fischen ist der sichtbare Teil des Seitenlinienorgans nicht ausgeprägt. Charakteristisch sind auch die tiefe V-förmige Gabelung der Schwanzflosse, die wie die Rückenflosse deutlich dunkel gefärbt sind. Die Schuppen am Bauch sind abgerundet und nicht gekielt, wie z. B. bei der Sprotte (lateinisch: Sprattus sprattus).
Wo lebt der Hering?
Der atlantische Hering lebt in sehr großen Schwärmen in den kühlen, sauerstoffreichen Zonen im Westatlantik (Küste South Carolinas / USA, südwestliche Grönland und entlang der Küste Kanadas), im Östlichen Atlantik (Norwegen bis Spanien) und der Nordsee, Ostsee, Irische See, Barentssee und Grönlandsee. Also kurz gesagt in nahezu allen küstennahen und Küstengewässern des nördlichen Atlantiks – von Kanada bis Russland.
Heringe sind bekannt für ausgedehnte und komplexe saisonale Wanderungen, auf denen sie oft hunderte Kilometer zwischen Laich-, Nahrungs- und Überwinterungsgebieten zurücklegen. Diese Wanderungen beeinflussen die Bestände und somit auch die Verfügbarkeit von Hering in den jeweiligen Fanggebieten. Heringe brauchen frisches und sauerstoffreiches Wasser, sie leben hauptsächlich im offenen Meer und in Tiefen bis 200 m bei Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad Celsius.
Heringsschwärme kommen regelmäßig auch in Küstennähe. Nachts folgen Heringe ihrer Hauptnahrung, dem Plankton bis unter die Wasseroberfläche. Die meisten Heringe werden in Norwegen und Dänemark gefischt, also in der Nordsee. Heringe kommen aber auch in der Ostsee vor. Der Fisch ist immer ein Wildfang. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Speisefischen und Meeresfrüchten. Die Zucht von Heringen wäre aufgrund der komplexen Lebensweise und hohen Anforderungen an Menge und Qualität der Nahrung nicht wirtschaftlich.

Wann hat der Nordatlantische Hering Saison?
Die Saison des Nordatlantischen Herings richtet sich nach der Laichzeit und ist von solcher Bedeutung, dass sie namensgebend für die unterschiedlichen Bestände ist. So unterscheidet man z. B. den Norwegischen Frühjahrslaicher vom Nordsee-Herbstlaicher und dem Frühjahrslaicher der westlichen Ostsee. Die Monate Mai und Juni sind die Hauptsaison für den Fang von Nordatlantischen Hering. Aufgrund der Laichzeit hat der Hering jetzt einen hohen Fettgehalt, genau richtig für die Weiterverarbeitung zu Matjesfilets und Doppelmatjes. Anders als bei anderen Lebensmitteln, wo z. B. religiöse Feste zu erhöhtem Konsum führen, bestimmt beim Hering sein natürlicher Zyklus die Saison. In dieser Zeit wird der Großteil der gefangenen Heringe direkt verarbeitet und die rohen Heringslappen dann eingefroren, um die durchgängige Produktion und Versorgung mit Matjes bis zur nächsten Laichzeit in 12 Monaten sicherzustellen. Daher ist frischer ganzer Hering ausgerechnet in der Hochsaison in den Fischereihäfen teilweise nur schwer zu bekommen, was sich infolge negativ auf die Verfügbarkeit bei uns im Onlineshop auswirken kann. Wenn wir die Verfügbarkeit zu Ihrem Wunschlieferdatum nicht garantieren können oder wir Zweifel haben, dass wir Ihrem Wunsch gerecht werden können, ist der Artikel für eine gewisse Zeit „nicht lieferbar“.
Nachhaltigkeit und Regulierung der Fischerei
Die Fischerei auf Hering unterliegt strengen Vorgaben zu Quoten (Mengen) und Zonen (Bereiche), über deren Einhaltung streng gewacht wird. Verstöße können mit empfindlichen Geldstrafen bis hin zu Fangverboten geahndet werden. Meist warten die Behörden schon im Hafen auf die einlaufenden Schiffe. Dank GPS können sie exakt verfolgen, wo das Schiff war und in welchen Zonen gefischt wurde. Zonenverletzungen werden sofort geahndet und auch bei Verstößen gegen die Fangquote greift die Fischereibehörde noch im Hafen durch. Das engmaschige Vorgehen stellt sicher, dass sich die Fischer penibel an die Quoten halten.
Die Kontrollen dienen dem Bestandsschutz und wirken der Überfischung entgegen. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Fischbestände und damit der Zukunft. Die Quoten werden -abhängig von der Biomasse im Wasser- jährlich neu festgelegt und somit wird sehr empfindlich auf Veränderungen im Meer reagiert.
Das war nicht immer so, die Bedeutung des Herings als Speisefisch und immer bessere Fangmethoden haben Ende der 60er und in den 70er Jahren zur Kollabierung verschiedener Heringsbestände geführt. Gemeinsam festgelegte Fangquoten der betroffenen Staaten führten Ende der 1980er Jahre wieder zur Erholung. Daten und Fakten zu Heringsbeständen werden seit vielen Jahrzehnten erfasst und ausgewertet, für den Norwegischen Frühjahrslaicher gehen die Bestandsberechnungen zurück bis ins Jahr 1907. Veränderungen der Verbreitungsgebiete einzelner Bestände haben in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten bei der Festlegung gemeinsamer Höchstfangmengen zwischen den Küstenländern und Fangnationen geführt, sodass derzeit jedes Land seine eigenen Quoten festlegt. Diese Situation macht die nachhaltige Befischung der Heringe schwierig, wodurch die Fischbestände seit einigen Jahren wieder einen Abwärtstrend zeigen.
Fang & Frische – So arbeiten wir bei sendafish.de
Wie wird Hering gefangen? Tradition und Technik: Heringsfang damals und heute.
Die Fischerei auf Hering genießt eine lange Tradition. Historiker vermuten, dass bereits in der Steinzeit Reusen zum Einsatz kamen. Eine auf das Jahr 1200 datierte Textstelle im ältesten Geschichtswerks Dänemarks, der “Gesta Danorum” beschreibt, wie die schiere Menge der Heringe im Sund die Schifffahrt zum Erliegen brachte und der Hering ohne Einsatz von Hilfsmitteln “mit der bloßen Hand” aus dem Meer gegriffen werden konnte.
Heute sind in der Heringsfischerei auf hoher See moderne Technologien wie Sonar, Echolot, GPS, Netz- und Fangmonitore unverzichtbar. Im Gegensatz zu anderen Fangmethoden wird beim Heringsfischen mit ca. 2% relativ wenig Beifang produziert und anders als beim Einsatz von Grundschleppnetzen die empfindlichen Ökosysteme am Meeresboden nicht beeinträchtigt. Während auf der offenen See bei der Jagd auf große Heringsschwärme industrielle Methoden wie Ringwaden und Pelagische Scherbrettnetze zum Einsatz kommen, wird dem Hering küstennah auch heute noch mit handwerklichen Methoden wie Reusen und Stellnetz nachgestellt, z. B. im Greifswalder Bodden.
Ringwaden sind mehrere 100 bis 1000 Meter lange und 100 bis 200 Meter in die Tiefe reichende Netze, die ringförmig um einen ganzen Fischschwarm ausgelegt werden. Am oberen Teil des Netzes befindet sich die sogenannte Schwimmleine, sie hält den oberen Teil des Netzes immer an der Oberfläche. Am unteren Ende des Netzes ist die sogenannte Zugleine angebracht, sie hilft beim Verschließen der Unterseite. Ist der Schwarm vom Netz umschlossen, wird so durch gleichzeitiges Verkürzen der Schwimmleine und Ziehen der Zugleine das Netz verschlossen und der Fischschwarm kann weder zu den Seiten noch nach unten entkommen. Anschließend werden die Fische an Bord gepumpt oder das gesamte Netz an Deck geholt.
Im Gegensatz zu den oberflächennahen Ringwaden werden Pelagische Scherbrettnetze in der Wassersäule geschleppt (zwischen Oberfläche und Meeresgrund). Der trichterförmige Netzkörper ist seitlich und an der Vorderseite mit Scherbrettern ausgestattet, die wie Flügel unter Wasser fungieren und das Netz aufhalten. Zusätzlich sind Schwimmkörper an der Oberseite und Gewichte auf der Unterseite für die vertikale Öffnung vorhanden. Von der deutschen Küste aus fahren die Heringskutter nachts in ihre Fanggebiete und suchen mit Echolot ausgerüstet nach Heringen. Ist ein Schwarm lokalisiert, wird allein oder im Verbund mit einem Partnerkutter das Schleppnetz ausgebracht.
Wie gesund ist Hering?
Dass der Speisefisch Hering positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat, wusste schon Bismarcks Leibarzt. Er verschrieb dem chronisch kränkelnden deutschen Kaiser 1880 eine Heringsdiät, die ihn tatsächlich vollständig heilte. Heute steht Hering an vierter Stelle der wichtigsten Fischarten in Deutschland und macht ca. 9% des Pro-Kopf-Verzehrs von Fisch aus. Dass Hering heute als wahres Superfood gilt, liegt vor allem am hohen Anteil der drei Spurenelemente Selen (begünstigt den Fettstoffwechsel), Iod und Fluor (gut für Zähne und Knochen). Mit ca. 17% Eiweißgehalt liegt der Hering als Proteinlieferant gleichauf mit Makrele und Lachs.
Zusätzlich ist Hering reich an gesunden, mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Omega 3 kann nicht vom Körper hergestellt werden und wird wegen der positiven Wirkung auf Blutzuckerspiegel und Immunsystem als regelmäßiger Bestandteil der Ernährung empfohlen. Der Verzehr von Hering wirkt entzündungshemmend, cholesterinsenkend, blutdruckregulierend und hilft bei der Muskelregenerierung.
Als kleiner Schwarmfisch steht Hering relativ weit unten in der Nahrungskette, wodurch Umweltgifte wie Quecksilber in deutlich geringerer Konzentration vorkommen als bei großen Raubfischen. Da Hering immer Wildfang ist und nicht gezüchtet wird, ist die Belastung mit Medikamenten beim Hering sehr unwahrscheinlich. Man sollte jedoch wissen, dass der Nährwertgehalt des Herings vom Zeitpunkt des Fangs, Ernährungszustand und besonders der Fortpflanzungsphase abhängt.
Matjesheringe beginnen im Frühjahr damit, neue Fettreserven aufzubauen. Sie sind noch nicht geschlechtsreif und enthalten noch keinen Rogen. Dafür reichern sich im Fettansatz die Geschmacksstoffe des Herings an. Ohne Innereien weist der Matjeshering einen Fettgehalt von ca. 14% auf. Der ganze Matjeshering, der auch grüner Hering genannt wird, hat eine höhere Qualität als der Hering. Vollheringe, die bereits Milch bzw. Rogen enthalten, sind im Geschmack nicht so intensiv wie der junge Hering.